Ratgeber für HIV-positive Menschen
Arbeits- & Beamtenrecht - Antidiskriminierungsgesetz (AGG) - Sozialgesetzbuch - Melde- & Schweigepflichten - Lebens- & Krankenversicherungen (Stand: 2025)
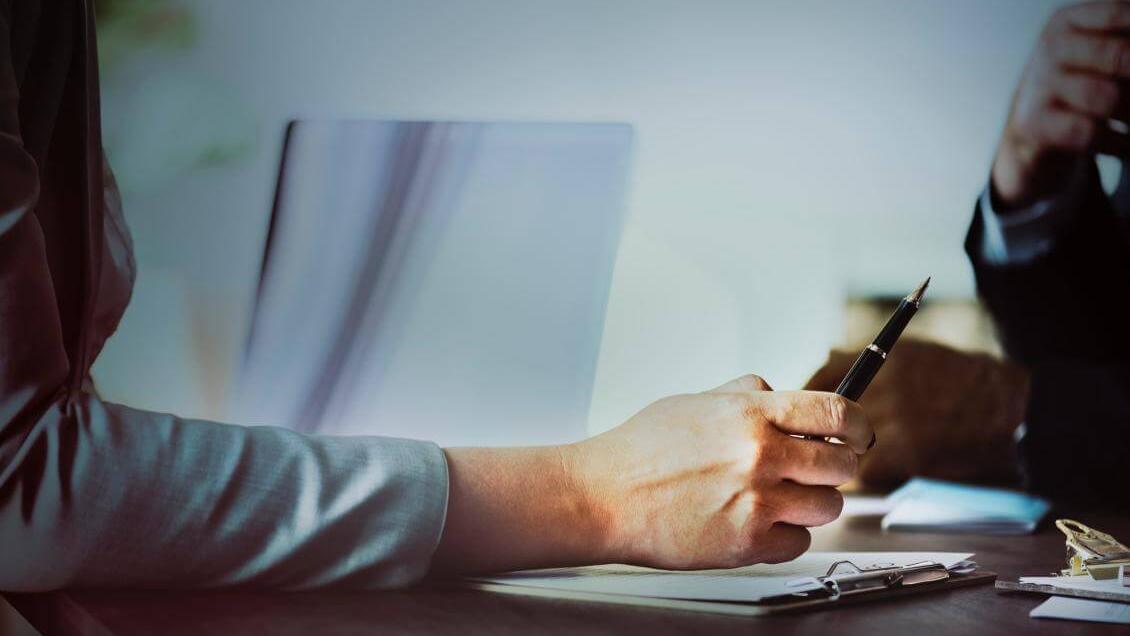
In Deutschland können inzwischen die meisten Menschen mit einer HIV-Infektion dank der medizinischen Fortschritte und Versorgung ein selbstbestimmtes und langes Leben führen. Sie sollten auch ein angst- und diskriminierungsfreies Leben führen können. Selbstbewusst, offen und ohne Angst vor Ausgrenzung leben zu können, ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Prävention und Therapie.
Inhaltsverzeichnis
- HIV-positive Bewerber*innen und Beschäftigte im Arbeits- und Beamtenrecht
1.1 Diskriminierungsschutz für HIV-Infizierte und an AIDS erkrankte Menschen
1.2 Darf eine Arbeitgeber*in nach einer HIV-Infektion oder AIDS Erkrankung fragen?
1.3 Eine HIV-Infektion steht einer Verbeamtung nicht entgegen
1.4 (Amtsärztliche) Eignungsuntersuchungen: HIV- und AIDS-Test
1.5 Bundeswehr: HIV-Infektion führt nicht per se zur Wehrdienstunfähigkeit
1.6 Kündigung bei HIV und AIDS - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX): Grad der Behinderung
- Wem gegenüber muss ich eine HIV-Infektion offenlegen? Mitteilungs- und Schweigepflichten
3.1 Muss ich meinen Sexualpartner*innen sagen, dass ich HIV-positiv bin?
3.2 Muss ich meinen Ärzt*innen sagen, dass ich HIV-positiv bin?
3.3 Wem müssen meine Ärzt*innen meine HIV-Infektion melden? Wie weit reicht die ärztliche Schweigepflicht? Wie sind die Auswirkungen auf Arztbriefe?
3.4 Verwendung von Daten für medizinische Forschung - Rechte im Verhältnis zwischen Patient*innen und Ärzt*innen
4.1 Dürfen Ärzt*innen und Krankenhäuser eine medizinische Behandlung von HIV-positiven bzw. von an AIDS erkrankten Menschen ablehnen?
4.2 Muss ich in einen HIV-Test einwilligen?
4.3 Datenschutzrechte - Private Lebens- und Krankenversicherungen
- Private Altersvorsorge
1. HIV-positive Bewerber*innen und Beschäftigte im Arbeits- und Beamtenrecht
1.1 Diskriminierungsschutz für HIV-Infizierte und an AIDS erkrankte Menschen
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet vor allem im Erwerbsleben die Diskriminierung aufgrund bestimmter, im Gesetz genannter Merkmale. Zu diesen geschützten Merkmalen zählt das Merkmal der Behinderung. Eine HIV-Infektion oder eine AIDS-Erkrankung stellt eine solche Behinderung dar. Dies wurde höchstrichterlich durch das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahr 2013 entschieden (Urteil vom 19.12.2013 - 6 AZR 190/12). Dies gilt selbst für eine symptomlose HIV-Infektion. Das Gericht begründet das mit der damit verbundenen sozialen Stigmatisierung. Eine solche Infektion führe zu einer chronischen Erkrankung, die sich auf die Teilhabe der Arbeitnehmer*in an der Gesellschaft auswirkt. Das gelte so lange, wie das gegenwärtig auf eine solche Infektion zurückzuführende soziale Vermeidungsverhalten und die darauf beruhenden Stigmatisierungen andauern. Unerheblich ist, ob die Leistungsfähigkeit der Betroffenen eingeschränkt ist.
Das AGG gilt nicht nur für Arbeitnehmer*innen und entsprechende Bewerber*innen, sondern auch für Beamt*innen sowie Bewerber*innen für eine Verbeamtung (§ 24 i.V.m. § 6 Abs. 1 AGG).
Werden Bewerber*innen oder Probebeamt*innen wegen einer HIV-Infektion nicht eingestellt oder nicht in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit übernommen, stellt das grundsätzlich eine verbotene Benachteiligung wegen ihrer „Behinderung“ dar (§§ 7 Abs. 1, 3 Abs. 1 AGG). Ausnahmsweise kann eine solche Benachteiligung aufgrund beruflicher Anforderungen gerechtfertigt und somit zulässig sein (§ 8 AGG). Im Falle einer verbotenen Benachteiligung können Bewerber*innen aber grundsätzlich nicht verlangen, angestellt oder verbeamtet zu werden (§ 15 Abs. 6 AGG). Bei Beamt*innen sowie Bewerber*innen für eine Verbeamtung kann in Ausnahmefällen jedoch ein Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder auf beruflichen Aufstieg aus Art. 33 Abs. 2 GG bestehen (BeckOGK/Benecke, 1.6.2024, AGG § 15 Rn. 1112).
Abgelehnte Bewerber*innen oder Probebeamt*innen können allerdings einen Anspruch auf Schadensersatz (gerichtet auf Ausgleich des Verdienstausfalls oder des Gehaltsunterschieds) und Entschädigung (Schmerzensgeld) haben (§ 21 Abs. 2 AGG). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass entsprechende Ansprüche in der Regel innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend gemacht werden müssen.
Solche Ansprüche können auch bestehen, wenn man Bewerber*innen statt der gewünschten Übernahme oder Weiterbeschäftigung im Beamtenverhältnis eine solche Übernahme oder Weiterbeschäftigung im Angestelltenverhältnis anbietet, da beide Beschäftigungsverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG unterschiedlich ausgestaltet sind.
Wichtiger Hinweis:
Wenn Sie Ansprüche aufgrund einer erlittenen Benachteiligung geltend machen möchten, empfehlen wir, anwaltlichen Rat einzuholen, da es sich immer um eine Einzelfallentscheidung handelt. Jeder Fall kann individuelle Besonderheiten aufweisen, die eine rechtliche Beratung erfordern. Unsere Darstellung dient lediglich als erste Orientierungshilfe und ersetzt nicht die professionelle Beratung durch eine Anwält*in.
Hintergrund
Mit Inkrafttreten des AGG ist das Diskriminierungsverbot aufgrund einer Behinderung ausdrücklich geregelt. Demnach ist die Benachteiligung wegen einer Behinderung bei Bewerbungen, Kündigungen und Entlassungen unzulässig. Ob unter den Begriff der Behinderung auch eine HIV-Infektion fällt, war früher nicht eindeutig geklärt.
Da mit dem AGG eine Richtlinie der EU umgesetzt wurde, muss die Auslegung des AGG europarechtskonform erfolgen. Was im Sinne der Richtlinie 2000/78/EG vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf als „Behinderung“ zu werten ist, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2013 entschieden.
In seinem Urteil zur Rechtssache HK Danmark (Urt. v. 11.04.2013 - C-335/11 und C- 337/11; NZA 2013, 553) hat der EuGH den Begriff der Behinderung im Sinne der Richtlinie 2000/78/EG aufgrund des Beitritts der EU zur UN-Behindertenrechtskonvention neu bestimmt.
Art. 1 Abs. 2 der UN-Behindertenrechtskonvention definiert den Begriff der „Behinderung“ wie folgt:
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“
Der EuGH hat festgestellt, dass auch eine ärztlich diagnostizierte heilbare oder unheilbare Krankheit eine Behinderung darstellt, wenn diese Krankheit eine Einschränkung mit sich bringt, die insbesondere auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren die Betreffenden an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmer*innen, hindern können, wenn diese Einschränkung von langer Dauer ist. Der EuGH hat darauf hingewiesen, dass eine Behinderung in diesem Sinne nicht nur bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit vorliegt, sondern auch, wenn nur noch in Teilzeit gearbeitet werden kann.
Damit stimmt die Definition der „Behinderung“ des EuGH in wesentlichen Teilen mit der Definition in der deutschen Sozialgesetzgebung überein (§ 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX) überein:
„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“
Unter den Begriff der Behinderung fällt auch die HIV-Infektion. So hat es das BAG klargestellt (Urteil vom 19.12.2013 - 6 AZR 190/12). In den Leitsätzen des Urteils heißt es:
„2. Eine symptomlose HIV-Infektion hat eine Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zur Folge. Das gilt so lange, wie das gegenwärtig auf eine solche Infektion zurückzuführende soziale Vermeidungsverhalten sowie die darauf beruhenden Stigmatisierungen andauern.“
1.2 Darf eine Arbeitgeber*in nach einer HIV-Infektion oder AIDS Erkrankung fragen?
Es ist zu unterscheiden: Arbeitgeber*innen dürfen grundsätzlich nicht nach einer HIV-Infektion fragen. Das gilt in Bewerbungsgesprächen genauso wie im laufenden Arbeitsverhältnis. Tun sie das trotzdem, darf die Bewerber*in / Arbeitnehmer*in lügen, d.h. die HIV-Infektion ausdrücklich verneinen (zu Ausnahmen sogleich). Denn in diesem Stadium besteht im Regelfall weder eine Leistungsminderung der Arbeitnehmer*in noch eine Ansteckungsgefahr bei der üblichen betrieblichen Tätigkeit. Grundsätzlich besteht entsprechend auch keine Pflicht der Bewerber*innen, den Arbeitgeber über eine HIV-Infektion zu informieren, ein entsprechendes Testzeugnisses vorzulegen oder einem HIV-Test zuzustimmen. Nach einer ausgebrochenen AIDS-Erkrankung darf die Arbeitgeber*in wohl fragen, da nach dem derzeitigen Stand der Medizin die Arbeitgeber*in nach wie vor mit einer Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer*in rechnen kann. Die medizinische Entwicklung, mit der sich auch die entsprechende rechtliche Handhabung des Fragerechts ändern kann, ist dabei im Blick zu behalten.
Ausnahmen von dem Grundsatz, dass Fragen nach einer HIV-Infektion unzulässig sind, bestehen nur unter engen Voraussetzungen. Die damalige Bundesregierung hat in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage „Zur sozialen und gesellschaftlichen Integration von HIV-positiven Menschen“ (BT-Drs. 17/7283 v. 07.10.2011, Frage 7) festgestellt:
„Es kann nur im Einzelfall beurteilt werden, ob eine HIV-Infektion die Eignung für eine bestimmte berufliche Tätigkeit einschränkt. Gesetzliche Regelungen, nach denen HIV- positive Menschen generell von einer bestimmten beruflichen Tätigkeit ausgeschlossen wären, gibt es nicht und werden von der Bundesregierung auch nicht für sachgerecht gehalten. […] Dies gilt bis auf wenige Ausnahmen auch für Personal, welches im medizinischen Bereich arbeitet. Zumindest für wirksam antiretroviral therapierte Personen ist weder die Entwicklung von Aids mit entsprechenden Krankheitssymptomen zu erwarten, noch sind nach menschlichem Ermessen berufsbedingte Übertragungsrisiken zu befürchten.“
Wie die Deutsche Aidshilfe in ihrer „Infomappe für die Beratung in Aidshilfen“ aufzählt, können aufgrund von europäischen Flugsicherheitsrichtlinien Pilot*innen und Kabinenpersonal auf HIV getestet werden. Ein positives Testergebnis steht einer Einstellung aber nicht entgegen. Bei Pilot*innen ist für die Einstellung insbesondere der allgemeine Gesundheitszustand entscheidend. Auch testen nicht alle Airlines ihre Bewerber*innen. Beispielsweise hat die Lufthansa den HIV-Test zur Einstellung abgeschafft (siehe dazu Pressemitteilung der UFO vom 06.04.2023). Ausnahmsweise dürfen Arbeitgeber*innen nach einer HIV-Infektion bei Tätigkeiten im Ausland / Berufen mit Reisetätigkeit fragen, wenn die Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend in einem Land mit Einreise / Aufenthaltsbeschränkung für HIV-Infizierte stattfinden würde. Eine HIV-Infektion steht aber einer durch Arbeitgeber*innen geforderten „Tropentauglichkeit“ nicht entgegen. Insbesondere ist heute medizinisch anerkannt, dass bei einem stabilen Immunsystem eine Gelbfieberimpfung durchgeführt werden kann.
Ein Fragerecht der Arbeitgeber*in besteht außerdem in Teilen der Chirurgie, wenn ein Ansteckungsrisiko für Dritte bestehen könnte. Dies ist bei Operationen der Fall, bei denen ein Verletzungsrisiko für die Chirurg*in besteht (bspw. Urologie, Gynäkologie, zahnmedizinische Eingriffe). Unabhängig vom Fragerecht kann ein Ausschluss von dieser Tätigkeit jedoch nicht erfolgen, wenn die Viruslast der Operierenden dauerhaft nicht nachweisbar ist (≤ 50 Kopien / ml) und die Empfehlungen der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten und der Gesellschaft für Virologie e.V. („Prävention der nosokomialen Übertragung von humanem Immunschwächevirus (HIV) durch HIV-positive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen“) eingehalten werden (z.B. das Tragen doppelter Handschuhe, regelmäßige arbeitsmedizinische Betreuung, mindestens vierteljährliche Kontrollen der HI-Viruslast, regelmäßige Betreuung durch eine in der HIV-Therapie erfahrenen Ärzt*in).
Wichtiger Hinweis:
Sollten Sie in einer der genannten Branchen durch Ihre Arbeitgeber*in nach einer HIV-Infektion gefragt werden und Ihre HIV-Infektion nicht offenlegen wollen, empfehlen wir, anwaltlichen Rat einzuholen, da es sich immer um eine Einzelfallentscheidung handelt. Jeder Fall kann individuelle Besonderheiten aufweisen, die eine rechtliche Beratung erfordern. Unsere Darstellung dient lediglich als erste Orientierungshilfe und ersetzt nicht die professionelle Beratung durch eine Anwält*in.
Hintergrund
Die Frage nach einer HIV-Infektion bzw. AIDS-Erkrankung betrifft sensible Gesundheitsdaten. Solche sind besonders geschützt und dürfen nur unter strengeren Voraussetzungen verarbeitet werden (vgl. Art. 9 Abs. 2 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)). Insbesondere muss im Beschäftigungskontext beachtet werden, dass betroffene Personen zwar grundsätzlich in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einwilligen können. Aufgrund des oftmals bestehenden Ungleichgewichts zwischen Arbeitgeber*in und Beschäftigten in (potenziellen) Arbeitsverhältnissen wird teilweise angenommen, dass eine Einwilligung oftmals nicht freiwillig erteilt und damit unwirksam ist. Arbeitgeber*innen sollten die Verarbeitung von Gesundheitsdaten daher regelmäßig auf eine andere Rechtsgrundlage stützen können.
Insbesondere dürfen Arbeitgeber*innen nach einer HIV-Infektion fragen, wenn sie diese Daten zur Wahrnehmung ihrer arbeits- oder sozialrechtlichen Rechte und Pflichten benötigen und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt (vgl. § 26 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Zulässig sind Fragen nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Bewerber*innen, die eine Kündigung (s.u.) generell rechtfertigen könnten. Fragen zum Gesundheitszustand sind daher zulässig, wenn sie auf potenzielle Ausfallzeiten oder Einschränkungen der Tätigkeit abzielen. Bezogen auf HIV-Infektionen bzw. AIDS-Erkrankungen dürfen Arbeitgeber*innen daher fragen, ob Krankheiten oder Beeinträchtigungen der Bewerber*innen bestehen, die deren Eignung für die Tätigkeit dauerhaft oder regelmäßig einschränken. Auch Fragen nach einer Ansteckungsgefahr für Kolleg*innen oder Dritte oder einer absehbaren Arbeitsunfähigkeit zum Dienstantritt oder bald danach, etwa durch eine akute Erkrankung, sind zulässig (Gola/Pötters, in: Gola/Heckmann, 3. Aufl. 2022, BDSG § 26 Rn. 130 f.).
Bei einer HIV-Infektion besteht in der Regel weder eine Tätigkeitseinschränkung noch eine Ansteckungsgefahr. Menschen mit HIV sind bei der alltäglichen Arbeit in aller Regel nicht ansteckend. Dies gilt auch für den Gesundheitsdienst, das Rettungswesen und die Bereiche mit erhöhter Infektionsgefahr (beispielsweise Arbeitsplätze in Operationssälen, medizinische und mikrobiologische Laboratorien, Endoskopie- und Dialyseeinheiten). Wenn in diesen Bereichen hygienisch einwandfrei gearbeitet wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion so gut wie ausgeschlossen.
Anti-retrovirale Medikamente reduzieren das Übertragungsrisiko von HIV zusätzlich um bis zu 96 Prozent. Bei zuverlässiger Einnahme der Medikamente über einen Zeitraum von etwa 6 Monaten sind in der Regel keine HIV-Viren mehr im Blut nachzuweisen. Damit sinkt das Übertragungsrisiko im Alltag oder bei einer invasiven medizinischen Behandlung etwa durch HIV-positive Ärzt*innen unter normalen Sicherheitsvorkehrungen gegen Null.
Bewerber*innen müssen auf unzulässige Fragen zu HIV-Infektionen nicht wahrheitsgemäß antworten. Eine falsche Antwort auf solche Fragen berechtigt die Arbeitgeber*in im Nachhinein weder zur Anfechtung nach §§ 119, 123 BGB noch zur verhaltensbedingten Kündigung. Bewerber*innen haben in diesem Fall also ein „Recht zur Lüge“.
1.3 Eine HIV-Infektion steht einer Verbeamtung nicht entgegen
Beamtenbewerber*innen werden in den Ländern grundsätzlich nicht auf HIV-Antikörper getestet. Dies gilt auch auf Bundesebene. Die Bundesregierung erwidert dazu in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage „Zur sozialen Lage HIV-positiver Menschen in Deutschland“ (BT-DRs. 18/3130 v. 11.11.2014, Frage 20):
„Bewerberinnen und Bewerber, die sich um eine Einstellung in den öffentlichen Dienst bewerben, sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung auszuwählen (Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG)). Hierzu gehört auch ein notwendiges Maß an gesundheitlicher Eignung. Daher muss der Dienstherr durch eine ärztliche Untersuchung die gesundheitliche Eignung zum Zeitpunkt der Einstellung feststellen. Eine gesundheitliche Eignung ist nicht gegeben, wenn im Rahmen einer zu treffenden Prognose eine vorzeitige dauernde Dienstunfähigkeit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze überwiegend wahrscheinlich ist.
Grundlage der Einstellungsuntersuchung ist die Beantwortung eines Fragebogens zum Gesundheitszustand, bei der u. a. chronische Erkrankungen und Medikamenteneinnahmen anzugeben sind. Fremdbefunde über bereits durchgeführte Untersuchungen oder Behandlungen werden ausgewertet.
Eine Testung auf eine HIV-Infektion ist nicht Bestandteil der Untersuchung. Die Beurteilung der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit bei einer Bewerberin oder einem Bewerber mit HIV-Infektion hängt wesentlich von dem individuellen Stand bzw. dem Verlauf der Krankheit sowie der sonstigen körperlichen Konstitution ab. Die meisten Menschen, die mit einer HIV-Infektion leben, sind in der Lage, uneingeschränkt einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Somit schließt eine HIV-Infektion für sich allein eine Feststellung der gesundheitlichen Geeignetheit nicht aus. Andererseits kann die Erkrankung, da sie bislang nicht heilbar ist, und wegen möglicher Nebenwirkungen der Medikation bei der Gesamtbeurteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit nicht unberücksichtigt bleiben.“
In diesem Zusammenhang haben schon verschiedene Gerichte festgestellt, dass Bewerber*innen nicht schon aufgrund seiner HIV-Infektion aus dem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen werden können. So hat das Verwaltungsgericht Berlin (Urteil v. 23.09.2022 – 5 K 322.18) entschieden, dass eine HIV-Infektion kein absoluter Ausschlussgrund für eine Beschäftigung im Berliner Feuerwehrdienst sein könne. Dies gelte jedenfalls bei entsprechender Therapie und einer Virenlast unter der Nachweisgrenze. Es sei auch nicht ohne weitere Anhaltspunkte überwiegend wahrscheinlich, dass etwaige Nebenwirkungen der von der Bewerber*in eingenommenen HIV-Medikamente dazu führen könnten, dass sie*er zukünftig den Anforderungen der Tätigkeit der Feuerwehrbeamt*in gesundheitlich nicht (mehr) gerecht würde oder dass aufgrund der HIV-Infektion vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze von regelmäßigen krankheitsbedingten Fehlzeiten über Jahre hinweg oder von einer Dienstunfähigkeit auszugehen sein werde. Entsprechend hat auch das Verwaltungsgericht Hannover (Urteil v. 18.07.2019 – 13 A 2059/17) bei einem Bewerber für den Polizeivollzugsdienst des Landes Niedersachsen entschieden.
Hintergrund
Die für das Gesundheitswesen zuständigen Minister*innen und Senator*innen der Länder – mit Ausnahme des bayerischen Vertreters – haben sich schon 1988 dafür ausgesprochen, dass „eine HIV-Infektion ohne Krankheitssymptomatik ... einer – auch auf Lebenszeit angelegten – Verbeamtung nicht entgegensteht“ (s. dazu Gesundheitsminister – AIDS-Prävention soll primär durch Aufklärung erfolgen, Frankfurter Rundschau, 18.10.1988 (auf S. 64 der verlinkten Sammlung)). Beamtenbewerber*innen werden deshalb nicht auf HIV-Antikörper getestet.
Bayern nahm zunächst eine Sonderstellung ein und hielt an der Praxis fest, Beamtenbewerber*innen auf eine HIV-Infektion zu testen. Diese Praxis wurde von vielen als diskriminierend und nicht zeitgemäß kritisiert, insbesondere angesichts der Fortschritte in der medizinischen Behandlung von HIV und der Tatsache, dass eine HIV-Infektion bei entsprechender Therapie keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit darstellt. Kritiker*innen argumentierten, dass die bayerische Praxis nicht nur gegen die Prinzipien der Gleichbehandlung verstieß, sondern auch unnötige Ängste und Stigmatisierung schürte (AIDS, Historisches Lexikon Bayerns).
Erst 1996 hat Bayern seine Haltung geändert und sich der bundesweiten Regelung angeschlossen, wonach Beamtenanwärter*innen nicht mehr generell einem HIV-Test zu unterziehen waren. Diese Änderung wurde als wichtiger Schritt hin zu einer diskriminierungsfreien Behandlung von HIV-positiven Menschen im öffentlichen Dienst begrüßt. Im Zeitraum von 1987 bis 1995 wurden im Rahmen von Einstellungsuntersuchungen rund 80.000 HIV-Tests vorgenommen, von denen lediglich vier positiv ausfielen. Die damit verbundenen Kosten betrugen rund 1,8 Mio. DM (HIV-Regeltest für Beamtenanwärter abgeschafft, Deutsche Ärzteblatt, 1996).
1.4 (Amtsärztliche) Eignungsuntersuchungen: HIV- und AIDS-Test
Eignungsuntersuchungen sind dann vorgeschrieben, wenn die vorgesehene Tätigkeit besondere körperliche Fähigkeiten erfordert oder wenn sie schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewerber*innen haben kann. Wie diese Eignungsuntersuchungen vorgenommen werden dürfen, was dabei gefragt und was untersucht werden darf, ist in der Regel in entsprechenden Richtlinien o.ä. genau festgelegt (Aligbe, Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen, 2. Auflage 2021, Rn. 82 ff.). Die Durchführung eines HIV- oder AIDS-Tests im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens ist, genauso wie das Verlangen über die Vorlage einer „Negativbescheinigung“, in der Regel nicht zulässig (Byers, Mitarbeiterkontrollen, 2. Auflage 2022, Rn. 253). Die Zulässigkeit solcher Untersuchungen orientiert sich am Fragerecht der Arbeitgeber*in im Bewerbungsgespräch: Darf die Arbeitgeber*in nach einer HIV-Infektion fragen, so kann sie in der Regel auch die Durchführung eines Tests verlangen (NK-ArbR/Brink/Joos, 2. Aufl. 2023, BDSG § 26 Rn. 63; NK-ArbR/Rudnik, 2. Aufl. 2023, BGB § 611a Rn. 311). Arbeitgeber*innen sind in den seltensten Fällen berechtigt, Bewerber*innen nach einer HIV-Infektion zu fragen. Entsprechend den Fallgruppen zum oben erläuterten Fragerecht, ist dies bei Pilot*innen und Kabinenpersonal, bestimmten Tätigkeiten im Ausland und Berufen mit Reisetätigkeit sowie in bestimmten Bereichen der Chirurgie möglich. Ist für eine Eignungsuntersuchung generell ein Bluttest vorgesehen und haben die Bewerber*innen eine grundsätzliche Zustimmung zu einem Bluttest abgegeben, so darf die Blutprobe wohl nicht auf eine HIV-Infektion untersucht werden, ohne dass die Bewerber*innen zuvor auf den HIV-Test hingewiesen worden sind oder ohne dass eine der oben genannten Fallgruppen vorliegt (vgl. Byers, Mitarbeiterkontrollen, 2. Auflage 2022, Rn. 254).
Auch wenn Arbeitgeber*innen grundsätzlich berechtigt sind, Bewerber*innen nach einer AIDS-Erkrankung zu fragen, kann ein AIDS-Test nur in Arbeitsbereichen mit besonderer Ansteckungsgefahr verlangt werden. Zudem ist die Zulässigkeit solcher Tests nur dann denkbar, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine AIDS-Erkrankung bestehen. Auch hier gilt, dass Bewerber*innen ausdrücklich auf die geplante AIDS-Untersuchung hinzuweisen sind. Das Ergebnis eines AIDS-Tests sollte mit Blick auf eine mitgeprüfte mögliche HIV-Infektion nicht durch das Labor der Arbeitgeber*in mitgeteilt werden, wenn nicht von vornherein ein HIV-Test zulässigerweise hätte verlangt werden können (vgl. Byers, Mitarbeiterkontrollen, 2. Auflage 2022, Rn. 255).
Wichtiger Hinweis:
Sollten Sie in einer der genannten Branchen durch Ihre Arbeitgeber*in nach einem HIV- oder AIDS-Test gefragt werden und Sie diesen nicht durchführen wollen, empfehlen wir, anwaltlichen Rat einzuholen, da es sich immer um eine Einzelfallentscheidung handelt. Jeder Fall kann individuelle Besonderheiten aufweisen, die eine rechtliche Beratung erfordern. Unsere Darstellung dient lediglich als erste Orientierungshilfe und ersetzt nicht die professionelle Beratung durch eine Anwält*in.
Wenn Beamtenbewerber*innen bei der amtsärztlichen Eignungsuntersuchung gefragt werden, ob sie sexuellen Kontakt zu homo- und bisexuellen Männern hatten oder ob sie schon einmal einen HIV-Antikörpertest haben durchführen lassen, haben sie grundsätzlich das Recht zur Lüge: Sie dürfen die Frage zur sexuellen Orientierung wahrheitswidrig verneinen, da allgemein kein Fragerecht bezüglich der sexuellen Orientierung besteht (Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, Kapitel IX Rn. 87). Auch die Frage zu einem durchgeführten HIV-Antikörpertest kann wahrheitswidrig verneint werden, soweit keine der genannten Fallgruppen vorliegt, in dem ein Fragerecht besteht. Eine vorliegende HIV-Infektion, auch wenn grundsätzlich kein Ausschlusskriterium für eine Verbeamtung, ist jedoch im Fragebogen zum Gesundheitszustand bei einer amtsärztlichen Eignungsuntersuchung anzugeben.
Die Rechtsauffassung, dass schwule bzw. bisexuelle Beamtenbewerber auf HIV getestet werden müssen, ist unserer Ansicht nach abwegig. Wenn Amtsärzt*innen auf die Durchführung eines HIV-Antikörpertests bestehen, weil sie wissen, dass der Bewerber schwul bzw. bisexuell ist, sollten die Bewerber unser vorbereitetes Schreiben verwenden. Erfahrungsgemäß lenken Amtsärzt*innen dann ein.
1.5 Bundeswehr: HIV-Infektion führt nicht per se zur Wehrdienstunfähigkeit
Der deutsche Gesetzgeber hat die Anwendbarkeit des AGG nicht auf Soldat*innen erstreckt (§ 24 AGG). Damit findet der Diskriminierungsschutz im Gegensatz zu Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen auf Soldat*innen keine Anwendung. Maßgeblich ist für Soldat*innen vielmehr das Soldatinnen- und Soldaten-Gleichbehandlungsgesetz (SoldGG). In § 1 Abs. 1 und 2 SoldGG kommt klar zum Ausdruck, dass dieses Gesetz für Soldat*innen, anders als das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, keinen Schutz vor Benachteiligungen aus Gründen einer Behinderung bietet; erfasst werden lediglich solche Personen, die ihre Schwerbehinderung im Soldatenverhältnis erlitten haben (§ 18 SoldGG).
Mit einem Schreiben vom 13.03.2017 hat uns das Bundesministerium der Verteidigung auf unsere Aufforderung, die Benachteiligung HIV-infizierter Soldat*innen in der Bundeswehr zu beenden, „über die nun in Kraft getretene neue Regelung zur Begutachtung von HIV-Infizierten“ informiert:
„Eine HIV-Infektion stellt unter einer wirksamen antiretroviralen Therapie, ausreichender Immunkompetenz sowie bei Fehlen von Krankheitszeichen seit dem 21. Februar 2017 keinen grundsätzlichen Hinderungsgrund mehr für die Einstellung, Dienstzeitverlängerung und Übernahme in den Status „Berufssoldat bzw. Berufssoldatin“ dar.“
Nach unserer Ansicht hat die Bundeswehr somit ihre Praxis im Rahmen des Zugangs zum Amt der Soldat*innen geändert und sich selbst dahingehend gebunden, dass im Prozess der Bestenauslese zur Stellenbesetzung beim Vorliegen der durch das Bundesministerium der Verteidigung genannten Voraussetzungen eine Benachteiligung wegen der HIV-Infektion nicht erfolgen darf. Bei pauschaler Ablehnung und dem Vorliegen dieser Voraussetzungen besteht unserer Ansicht nach ein Anspruch auf Berücksichtigung im Bewerbungsverfahren nach Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit der Selbstbindung der Bundeswehr (vgl. BAG Urt. v. 29.2.2024 – 8 AZR 187/23; BVerwG, Urt. v. 10.12.2020 – 2 A 2/20)
1.6 Kündigung bei HIV und AIDS
In Deutschland können Arbeitgeber*innen ihren Arbeitnehmer*innen in der Regel nicht ohne hinreichenden Grund kündigen. Das gilt jedenfalls, sobald eine Arbeitnehmer*in mehr als sechs Monate bei ihrer Arbeitgeber*in beschäftigt ist und diese mehr als zehn Arbeitnehmer*innen in ihrem Betrieb beschäftigt. In diesem Fall genießt die Arbeitnehmer*in Kündigungsschutz. Kündigungen sind nur aus betriebsbedingten, personenbedingten oder verhaltensbedingten Gründen erlaubt.
Selbst wenn die Arbeitgeber*in an sich zur Kündigung berechtigt wäre, etwa weil sich die Arbeitnehmer*in noch in der Probezeit befindet, ist eine diskriminierende Kündigung unwirksam (entgegen dem missverständlichen Gesetzeswortlaut in § 2 Abs. 4 AGG). Die Arbeitgeber*in darf deshalb HIV-positiven Arbeitnehmer*innen grundsätzlich nicht aufgrund der Infektion kündigen. Dies würde eine verbotene Benachteiligung wegen ihrer „Behinderung“ darstellen. Etwas anderes kann gelten, wenn eine der oben genannten Berufsgruppen betroffen ist, wo die Arbeitgeber*in ein Fragerecht bezüglich einer HIV-Infektion hat und folglich ein berechtigtes Interesse, dass die Arbeitnehmer*innen nicht infektiös sind – ein pauschales Kündigungsrecht der Arbeitgeber*in besteht nicht. Soweit die Viruslast dauerhaft nicht nachweisbar ist (≤ 50 Kopien / ml), sollte aber auch bei diesen Fallgruppen eine Kündigung nicht möglich sein..
Ob einer an AIDS erkrankten Person gerade wegen dieser Erkrankung gekündigt werden darf, richtet sich nach den gleichen Grundsätzen, wie bei anderen Erkrankungen. Grundsätzlich kann eine Krankheit für sich allein genommen eine Kündigung nicht rechtfertigen – allerdings stellt diese auch kein Kündigungshindernis dar. Eine krankheitsbedingte Kündigung ist möglich, wenn eine begründete Prognose aufgestellt werden kann, dass die die künftigen Fehlzeiten der jeweiligen Arbeitnehmer*innen infolge Krankheit in voraussichtlich so erheblichem Umfang vorliegen werden, dass diese zu erheblichen und deshalb der Arbeitgeber*in letztlich nicht mehr zumutbaren betrieblichen und/oder wirtschaftlichen Belastungen führen würden. Nach dem gegenwärtigen Stand der Medizin bestehen bei einer AIDS-Erkrankung keine Heilungschancen, sodass der Ausbruch der Erkrankung regelmäßig zu einer erheblichen Minderung der Leistungsfähigkeit der erkrankten Person führt. Ausgehend vom individuellen Krankheitsverlauf kann die Kündigung entweder wegen lang andauernder Erkrankung oder wegen häufiger Kurzerkrankung und den darauf resultierenden Fehlzeiten in Betracht kommen. Entscheidend für die begründete Prognose der künftigen Fehlzeiten ist aber der individuelle Zustand und Krankheitsverlauf der Betroffenen im Einzelfall.
Schwerbehinderte Menschen und Arbeitnehmer*innen, die einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, genießen darüber hinaus einen besonderen Kündigungsschutz. Eine ihnen gegenüber ausgesprochene Kündigung ist ohne vorherige Zustimmung des Integrationsamtes unwirksam (§ 168 SGB IX). Dieser Kündigungsschutz gilt auch, wenn der Kündigungsschutz der Arbeitgeber*in nicht bekannt ist. In einem solchen Fall ist die Arbeitgeber*in aber in der Regel innerhalb von drei Wochen nach der Kündigung über die Schwerbehinderung zu informieren.
Besteht in dem Betrieb, in dem die Arbeitnehmer*in beschäftigt ist, eine sog. Schwerbehindertenvertretung, muss diese vor Ausspruch der Kündigung von der Arbeitgeber*in angehört werden. Eine ohne vorherige Anhörung der Schwerbehindertenvertretung ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
Wichtiger Hinweis:
Wenn Ihre Arbeitgeber*in Ihnen aufgrund Ihrer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung gekündigt hat und Sie sich dagegen wehren möchten, sollten Sie schnellstmöglich anwaltlichen Rat einholen. Grundsätzlich wird auch eine rechtswidrige Kündigung nach drei Wochen wirksam, wenn Sie keine Klage dagegen erheben.
Jede Kündigung ist einer Einzelfallprüfung zu unterziehen und kann individuelle Besonderheiten aufweisen, die eine rechtliche Beratung erfordern. Unsere Darstellung dient lediglich als erste Orientierungshilfe und ersetzt nicht die professionelle Beratung durch eine Anwält*in.
2. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX): Grad der Behinderung
Menschen mit HIV und AIDS können beim zuständigen Integrationsamt (beispielsweise bei Ämtern für Soziale Angelegenheiten) die Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) beantragen. Wird ein GdB von 50 oder höher festgestellt, sind Antragstellende als schwerbehinderte Menschen im Sinne des Schwerbehindertenrechts anerkannt. Der GdB ist unabhängig von der beruflichen Leistungsfähigkeit, so dass auch schwerbehinderte Menschen voll leistungsfähig sein können.
Die Bewertung orientiert sich in der Regel an den „Versorgungsmedizinische Grundsätzen“ (Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung). Dort wird unter Punkt 16.11 (Immundefekte) für die HIV-Infektion bestimmt:
„Erworbenes Immunmangelsyndrom (HIV-Infektion)
d. HIV-Infektion ohne klinische Symptomatik: 10 (Grad der Behinderung)
e. HIV-Infektion mit klinischer Symptomatik
• geringe Leistungsbeeinträchtigung (z. B. bei Lymphadenopathie syndrom [LAS]): 30-40
• stärkere Leistungsbeeinträchtigung (z. B. bei AIDS-related complex [ARC]): 50-80
• schwere Leistungsbeeinträchtigung (AIDS-Vollbild): 100"
Bei diesen Zahlen handelt es sich aber nur um Anhaltspunkte. Das Integrationsamt stellt in jedem konkreten Einzelfall den aktuellen GdB unter Berücksichtigung aller körperlichen, geistigen und seelischen Mängel fest. Es ist daher wichtig, beim Feststellungsverfahren auf alle Symptome hinzuweisen. Zu beachten ist aber, dass eine Feststellung über den GdB nur getroffen wird, wenn insgesamt ein GdB von wenigstens 20 vorliegt (§ 152 Abs. 1 S. 5 SGB IX).
Menschen mit festgestellter Behinderung können einen mit dem GdB steigenden, wenn auch geringen, Steuerfreibetrag geltend machen (§ 33b EStG). Dieser Steuerfreibetrag kann anstatt der tatsächlichen außergewöhnlichen Belastungen nach § 33 EStG geltend gemacht werden. Schwerbehinderten Menschen steht ein Zusatzurlaub von jährlich fünf weiteren Arbeitstagen zu (§ 208 SGB IX). Außerdem können sie unter gewissen Voraussetzungen freiwillig der gesetzlichen Krankenkasse beitreten (§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB V) sowie Vergünstigungen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, bei der Kraftfahrzeugsteuer und bei den Rundfunk-, Fernseh- und Telefongebühren erlangen.
Entsprechend den Äußerungen zum Fragerecht über eine HIV-Infektion brauchen Arbeitnehmer*innen beim Wechsel zu einer neuen Arbeitgeber*in Fragen nach der bloßen Behinderteneigenschaft aufgrund des AGG grundsätzlich nicht wahrheitsgemäß zu beantworten. Zulässig sind jedoch Fragen nach solchen Behinderungen, die den betrieblichen Arbeitsablauf konkret beeinträchtigen oder dazu führen, dass Bewerber*innen die vorgesehene Arbeit nicht oder nur eingeschränkt ausüben können.
Jedenfalls nach Ablauf der ersten sechs Monate müssen Arbeitnehmer*innen ihre Arbeitgeber*in von der Anerkennung als schwerbehinderter Mensch unterrichten, damit dieser nicht unnötig Ausgleichsabgaben zu zahlen braucht. Solche Ausgleichsabgaben müssen Arbeitgeber*innen bezahlen, die zu wenig schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Es wird teilweise auch vertreten, dass ein Fragerecht nach einer Schwerbehinderung auch innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses besteht, damit die Arbeitgeber*in ihre gesetzlichen Schutzpflichten erfüllen kann. Zur Unterrichtung der Arbeitgeber*in reicht die Vorlage des Schwerbehindertenausweises aus. Den Feststellungsbescheid mit der Diagnose braucht die Arbeitnehmer*in nicht vorzuzeigen.
Wichtiger Hinweis:
Sollten Sie durch Ihre Arbeitgeber*in nach einer Schwerbehinderung gefragt werden, empfehlen wir, anwaltlichen Rat einzuholen, da die Rechtslage zur Pflicht der Offenlegung einer Schwerbehinderung nicht abschließend geklärt ist und es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt. Jeder Fall kann individuelle Besonderheiten aufweisen. Unsere Darstellung dient lediglich als erste Orientierungshilfe und ersetzt nicht die professionelle Beratung durch eine Anwält*in.
3. Wem gegenüber muss ich eine HIV-Infektion offenlegen? Mitteilungs- und Schweigepflichten
3.1 Muss ich meinen Sexualpartner*innen sagen, dass ich HIV-positiv bin?
Es gibt in Deutschland kein Gesetz, Sexpartner*innen zu offenbaren, dass eine HIV-Infektion vorliegt. Es besteht jedoch die Verpflichtung, Sexualpartner*innen vor einer Infektion zu schützen. Dem ist in der Regel durch den Gebrauch eines Kondoms genüge getan, wobei die Schutzvorkehrungen den entsprechenden Sexualhandlungen anzupassen sind. Sollte beim ordnungsgemäßen Kondomgebrauch eine Infektion stattfinden, zum Beispiel weil ein Kondom reißt oder abrutscht, drohen keine strafrechtlichen Konsequenzen, solange die Sexualpartner*innen anschließend über ihr Ansteckungsrisiko aufgeklärt werden.
HIV-positive Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen und auch keine Anhaltspunkte haben, dass sie infiziert sein könnten, können strafrechtlich nicht belangt werden, wenn sie andere Menschen anstecken. Menschen mit HIV, die sich der gesteigerten Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion bewusst sind, sich jedoch (noch) nicht haben testen lassen und deshalb nicht definitiv wissen, ob sie infiziert sind, können strafrechtlich unter Umständen wegen fahrlässiger Körperverletzung belangt werden, wenn sie andere Menschen anstecken.
Wissen Betroffene aufgrund eines HIV-Antikörpertests von ihrer Infektion, müssen sie Sexualpartner*innen über die Infektion aufklären oder beim Geschlechtsverkehr geeignete Schutzmaßnahmen treffen. Tun sie das nicht, machen sie sich wegen (versuchter) gefährlicher Körperverletzung strafbar, auch wenn sich die Sexualpartner*innen nicht mit dem HI-Virus anstecken. Kann nachgewiesen werden, dass der ungeschützte Geschlechtsverkehr zur Weitergabe der Infektion geführt hat, werden sie wegen vollendeter gefährlicher Körperverletzung bestraft.
Als geeignete Schutzmaßnahme gilt der Schutz durch Therapie. In diesen Fällen gilt Sex auch ohne Kondom bei einer stabilen Viruslast unter der Nachweisgrenze durch die antiretrovirale Therapie (ART) als „Safer Sex“. Die Deutsche AIDS-Hilfe schreibt dazu:
„Im Falle einer Anklage muss der/die Beklagte nachweisen, dass er/sie unter Therapie ist und die Viruslast stabil unter der Nachweisgrenze liegt. In der letzten Zeit kam es dann zum Freispruch bzw. wurden die Klagen erst gar nicht zugelassen. Im Einzelfall kann es aber auch heute noch zu schwierigen Prozessen kommen, da sich noch nicht alle Gerichte mit der Evidenz von Schutz durch Therapie beschäftigt haben und ggfs. der/die Beklagte in die nächste Instanz gehen muss. Im Fall einer Anklage ist es unbedingt ratsam, vor jeglicher Aussage auch bei der Polizei, einen Rechtsbeistand einzuholen.“
Eine Strafbarkeit des HIV-positiven Menschen bei Sexualkontakten ohne geeignete Schutzmaßnahmen scheidet aus, wenn die volljährigen und geistig voll zurechnungsfähigen Sexualpartner*innen im Wissen aller Umstände der HIV-Infektion zustimmen. Die Deutsche AIDS-Hilfe rät jedoch dazu, um auf der juristisch sicheren Seite zu sein, ein solches Einverständnis schriftlich oder vor Zeugen festzuhalten, damit im Zweifelsfall das Einverständnis nachgewiesen werden kann.
Diese Rechtslage gilt nur für Deutschland. Andere Länder, auch innerhalb Europas, haben andere Regelungen zur Strafbarkeit von Sex zwischen HIV- positiven und HIV-negativen Menschen.
3.2 Muss ich meinen Ärzt*innen sagen, dass ich HIV-positiv bin?
Die Frage, ob HIV-infizierte Patient*innen von Rechts wegen verpflichtet sind, ihre Ärzt*innen auf die Infektion hinzuweisen, ist nicht abschließend geklärt und in der Rechtswissenschaft umstritten.
Einige Rechtswissenschaftler*innen sind der Meinung, ein solcher Hinweis der Patient*innen könne nur den Sinn haben, die Ärzt*innen daran zu erinnern, die erforderlichen hygienischen Schutzmaßnahmen sorgfältig zu beachten. Das gehöre aber ohnehin zu den Regeln der ärztlichen Kunst.
Andere halten diese Rechtsauffassung für nicht haltbar. Die Information über eine bereits bestehende HIV-Infektion diene zum einen dem berechtigten Schutzinteresse der Ärzt*innen und des medizinischen Personals. Zum anderen könne eine solche Information auch im Interesse der Patient*innen selbst geboten sein, denn sie ermögliche eine zweckmäßige und angemessene ärztliche Behandlung; diagnostische Umwege und für die Patient*innen gefährliche Therapieverfahren könnten vermieden werden.
Auch wenn wir uns als Verband einen offenen Umgang von HIV-infizierten Patient*innen mit ihren Ärzt*innen wünschen (insbesondere um mögliche gesundheitliche Risiken zu verhindern) verstehen wir, dass in bestimmten Fällen eine HIV-infizierte Patient*in eine Infektion für sich behalten möchte. Nach unserer Einschätzung sollte es zu keinen juristischen Konsequenzen für HIV-infizierte Patient*innen kommen, wenn diese ihre Infektion bei alltäglichen ärztlichen Behandlungen verschweigen. Lediglich bei chirurgischen und bei größeren zahnmedizinischen Eingriffen sollte eine Infektion den Behandelnden offenbart werden.
Etwas anderes gilt jedoch, sollte es bei der Behandlung – gegebenenfalls auch durch einen Behandlungsfehler durch die Ärzt*in – zu einem Risikokontakt kommen, beispielsweise wenn sich die Ärzt*in selbst verletzt und so mit Blut der HIV-infizierten Patient*in Kontakt kommt. Die behandelnde Ärzt*in muss über ihren Risikokontakt aufgeklärt werden, um entsprechende Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Ein Verschweigen der HIV-Infektion kann in solchen Konstellationen zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.
3.3 Wem müssen meine Ärzt*innen meine HIV-Infektion melden? Wie weit reicht die ärztliche Schweigeplicht? Wie sind die Auswirkungen auf Arztbriefe?
Ärzt*innen sind verpflichtet, jeden Nachweis von HIV an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden. Diese Meldepflicht ergibt sich aus § 7 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 IfSG. Eine solche Meldung erfolgt jedoch nicht namentlich. Die Identität des Betroffenen wird dabei nicht offenbart. Außerdem können Ärzt*innen freiwillig anonymisierte Fallberichte an das AIDS-Fallregister melden. Auch hier erfolgt die Meldung gegenüber dem RKI. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des RKI.
Daneben gilt jedoch grundsätzlich die ärztliche Schweigepflicht. Ärzt*innen sind aus verschiedenen rechtlichen Gründen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Beispielsweise enthalten die ärztlichen Berufsordnungen der Landesärztekammern eine solche Schweigepflicht. Eine Schweigepflicht folgt außerdem aus dem zwischen Ärzt*in und Patient*in geschlossenen Behandlungsvertrag und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Patient*in. Die Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht durch Ärzt*innen ist nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch (StGB) unter Strafe gestellt.
Auch wenn die ärztliche Schweigepflicht innerhalb des internen Praxis- und Klinikbereichs nur eingeschränkt gilt, Mitarbeitende im Praxis- und Klinikbereich sollten nur Zugriff auf Informationen über eine mögliche HIV-Infektion der Patient*in haben, wenn ihre Tätigkeit in einem inneren funktionalen Zusammenhang mit der Behandlung steht. Das sind solche Mitarbeitende, die notwendigerweise und unmittelbar, sei es in der Pflege oder in der Verwaltung, mit den betreffenden Patient*innen befasst sind. Mitarbeitende dürfen demnach nicht wahllos über eine HIV-Infektion informiert werden. Dies muss auch bei der Dokumentation und Weitergabe der Befunde und Behandlungsdaten, bei der Aufbewahrung dieser Unterlagen und bei der Abrechnung mit den Krankenkassen berücksichtigt werden.
Vor einer Weitergabe des HIV-Testergebnisses im Arztbrief muss – außer die Weitergabe der Information ist für die Behandlung durch die Ärzt*in, die den Arztbrief ausstellt, erforderlich – das Einverständnis der Patient*innen eingeholt werden, sofern nicht nach den Umständen von einer stillschweigenden Einwilligung ausgegangen werden kann. Gegebenenfalls ist in dem Arztbrief ein Hinweis auf die Unvollständigkeit aufzunehmen. Allerdings können Patient*innen der Weiterleitung eines solchen Arztbriefes auch widersprechen.
In Ausnahmefällen können die Ärzt*innen aufgrund eines sogenannten „rechtfertigenden Notstandes“ gemäß § 34 StGB zu Meldungen und Warnungen gegenüber Dritten befugt sein, etwa wenn sie befürchten, dass Patient*innen andere Menschen mit HIV anstecken. Eine solche Meldung oder Warnung kommt aber immer nur als letztes Mittel in Betracht. Zunächst müssen sie mit Nachdruck versuchen, ihre Patient*innen zur Einsicht zu bewegen. Dazu gehören gegebenenfalls auch Bemühungen, die Patient*innen durch eine psychotherapeutische Behandlung zu stabilisieren. Nur wenn alle in Betracht kommenden Versuche sich als erfolglos erweisen, dürfen Ärzt*innen ihre Schweigepflicht brechen.
Wenn nicht nur die HIV-positive Person, sondern auch deren Partner*innen zu den Patient*innen einer Ärzt*in gehören, dann können Ärzt*innen verpflichtet sein, der Partner*in die HIV-Infektion zu offenbaren. In einem solchen Fall obliegen die Ärzt*innen auch gegenüber den Partner*innen vertragliche Fürsorgepflichten (OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 8. 7. 1999 - 8 U 67/99). Entscheidend ist aber auch in solchen Fällen zunächst die Abwägung der Ärzt*innen, ob es zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren für die Partner*innen erforderlich ist, die ärztliche Schweigepflicht gegenüber der HIV-positiven Person zu durchbrechen. Nur wenn dies zu bejahen ist, müssen Ärzt*innen Partner*innen unterrichten. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die HIV-positive Person, auch nach ausdrücklicher Aufforderung durch die behandelnde Ärzt*in, ihre*seine Partner*in nicht über die HIV-Infektion aufklärt und auch nicht anders vor einer Infektion schützt.
Hintergrund
Früher wurde die rechtliche Frage aufgeworfen, ob sich Ärzt*innen, AIDS-Beratungsstellen oder sonstige Personen nach § 138 StGB strafbar machen, wenn sie „uneinsichtige“ Patient*innen / HIV-Infizierte nicht anzeigen. Nach dieser Vorschrift macht sich wegen Unterlassung einer Anzeige an „die Behörde oder den Bedrohten“ nur strafbar, wer von dem Vorhaben oder Ausführung eines Totschlags zu einer Zeit glaubhaft erfährt, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann. Die praktische Relevanz in der Vergangenheit war schon fraglich, da sich früher bei HIV/ AIDS nie feststellen ließ, von wem die betroffene Person mit HIV angesteckt wurde und weil man nicht ausschließen konnte, dass sich beispielsweise die Partner*innen der betreffenden Patient*in schon vorher entweder bei dieser oder bei anderen Personen angesteckt haben. Zwischenzeitlich hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass der ungeschützte Geschlechtsverkehr von HIV-Infizierten in aller Regel kein versuchter Totschlag, sondern eine (versuchte) gefährliche Körperverletzung darstellt (s.o). Die geplante Körperverletzung ist aber anders als Totschlag nicht anzeigepflichtig.
3.4 Verwendung von Daten für medizinische Forschung
Grundsätzlich dürfen die behandelnden Ärzt*innen Daten der Patient*innen auch für eigene Forschungsarbeiten verwenden – auch ohne Einwilligung der Patient*innen. Grundlage dafür ist § 27 BDSG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 lit. j DSGVO. § 27 Abs. 3 BDSG schreibt dabei jedoch vor, dass die Daten der Patient*innen zu anonymisieren bzw. ggf. zu pseudonymisieren sind, soweit und sobald dies nach dem Forschungszweck möglich ist.
Ob die Patient*innendaten für Forschungsarbeiten Dritter ohne Einwilligung der Patient*innen übermittelt und verwendet werden dürfen, ist nach der aktuellen Gesetzeslage nicht abschließend geklärt. In der Praxis holen Ärzt*innen und Krankenhäuser vor der Weitergabe von Patient*innendaten zu Forschungszwecken eine Einwilligung der Patient*innen ein. Sollte eine Weitergabe der Patient*innendaten nicht gewünscht sein, so ist zu empfehlen, eine solche Einwilligung zu verweigern bzw. zu widerrufen. Wird die Einwilligung der Patient*innen in die Verarbeitung personenbezogener Daten für epidemiologische oder andere Forschungszwecke mit dem Behandlungsvertrag derart gekoppelt, dass die ärztliche Behandlung von der Erteilung dieser Einwilligung abhängig gemacht wird, ist die Einwilligung unwirksam.
In jedem Fall müssen Patient*innen vorab über die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten für Forschungszwecke nach Art. 13, 14 DSGVO insbesondere über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung und ihre Rechte nach der DSGVO informiert werden.
Zum datenschutzrechtlichen Hintergrund
Der Umstand, dass eine Person mit HIV infiziert ist, ist als sensibles Gesundheitsdatum durch die DSGVO besonders geschützt. Art. 9 Abs. 1 DSGVO verbietet die Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Sie sieht aber Ausnahmen mit besonderen Voraussetzungen (Art. 9 Abs. 2 DSGVO) vor. Eine solche Ausnahme liegt etwa vor, wenn die betroffene Person ausdrücklich in die Verarbeitung einwilligt, Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.
Allerdings erlaubt die DSGVO dem nationalen Gesetzgeber unter bestimmten Bedingungen, weitere Ausnahmen von dem generellen Verarbeitungsverbot vorzusehen. Der deutsche Gesetzgeber hat hiervon u.a. durch § 27 BDSG Gebrauch gemacht, der eine Verarbeitung zu Zwecken der wissenschaftlichen und historischen Forschung erlaubt (sog. Forschungsprivileg). In der juristischen Literatur ist umstritten, ob die Verarbeitung lediglich auf § 27 BDSG gestützt werden kann oder ob ergänzend Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO heranzuziehen ist. Inhaltlich ähneln sich beide Vorschriften, da sie jeweils eine Interessenabwägung vorsehen. Die berechtigten Interessen der Forschungseinrichtung und der Allgemeinheit an Forschung und freier Wissenschaft müssen jeweils die individuellen Interessen der betroffenen Person überwiegen. Im Einklang mit Erwägungsgrund 159 DSGVO wird das Forschungsprivileg weit verstanden. Es soll sowohl die öffentliche als auch die – kommerzielle – private Forschung erfassen. Die Daten dürfen daher für vielfältige wissenschaftliche Zwecke genutzt werden (vgl. Krohm, in: Gola/Heckmann, 3. Aufl. 2022, BDSG § 27 Rn. 2).
Neben der Interessenabwägung beschränkt auch die sog. Erforderlichkeit die Verarbeitung. Sie besagt, dass die Verarbeitung zwingend für den angestrebten Zweck erforderlich sein muss. Das bedeutet, dass etwa keine „Klar-Gesundheitsdaten“ zu Forschungszwecken verarbeitet werden dürfen, wenn die Forschung auch mit anonymisierten Daten durchgeführt werden kann (Pauly, in: Paal/Pauly, 3. Aufl. 2021, BDSG § 27 Rn. 7). Anonymisierung bedeutet, dass die personenbezogenen Daten so verändert werden, dass die betroffene Person nicht mehr identifiziert werden kann. Mit anderen Worten: Niemand darf mehr nachvollziehen können, zu wem die Daten ursprünglich gehörten. Lässt sich der Forschungszweck – wie wohl in den meisten Fällen – auch mit anonymisierten Daten erreichen, besteht sogar eine Pflicht zur Anonymisierung (vgl. § 27 Abs. 3 BDSG). Die Anonymisierungspflicht gilt zu jedem Zeitpunkt des jeweiligen Forschungsprojekts. Solange eine Anonymisierung im Hinblick auf den Forschungszweck (noch) nicht möglich ist, müssen personenbezogene Daten zumindest pseudonymisiert werden. Das bedeutet, dass z.B. der Name der betroffenen Person durch eine Zahl oder ein sonstiges „Pseudonym“ (z.B. Patient #1) ersetzt wird. Über eine Liste mit den Klarnamen lässt sich aber herausfinden, wie Patient #1 heißt. Diese sog. Re-Identifizierung der betroffenen Person ist nur erlaubt, wenn dies für den Forschungszweck erforderlich, also unbedingt notwendig ist. Außerdem muss die Liste besonders gesichert werden. Sie ist insbesondere getrennt aufzubewahren. Zusätzlich müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Liste zu schützen und z.B. den Zugriff unberechtigter Personen zu verhindern.
Die Veröffentlichung von Gesundheitsdaten, bei denen eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht möglich ist, ist nur in Ausnahmefällen zulässig (§ 27 Abs. 4 BDSG). Die betroffene Person muss ausdrücklich einwilligen oder die Veröffentlichung für die zeitgeschichtliche Forschung unerlässlich sein. Dies erfordert erneut eine sorgfältige Abwägung mit den regelmäßig stark beeinträchtigten, verfassungsrechtlich geschützten Interessen der betroffenen Person (Pauly, in: Paal/Pauly, 3. Aufl. 2021, BDSG § 27 Rn. 20 ff.). Dies ist praktisch nicht relevant.
Die Verwendung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken ist derzeit Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens auf EU-Ebene. Es soll ein Gesundheitsdatenraum, der sog. European Health Data Space („EHDS“) u.a. zum Austausch von Gesundheitsdaten nach dem Gedanken des „Datenaltruismus“ geschaffen werden. Das Europäische Parlament hat hierzu in erster Lesung bereits einen Entwurf der EHDS-Verordnung (P9_TA(2024)0331) beschlossen. Dieser sieht u.a. vor, dass jeder, der über Gesundheitsdaten verfügt, wie Krankenhäuser und Arztpraxen, diese proaktiv bestimmten Einrichtungen u.a. für Forschung und weitere Zwecke wie Ausbildung, Lehre und Patient*innensicherheit zur Verfügung stellen soll. Patient*innen sollen u.a. dadurch geschützt werden, dass ihre Daten grundsätzlich nur anonymisiert weitergegeben werden dürfen. Bei einer Anonymisierung ist kein Rückschluss auf die betroffene Person mehr möglich. Patient*innen müssen zudem über die Verwendung informiert werden und können dieser widersprechen (sog. Opt-out-Lösung).
4. Rechte im Verhältnis zwischen Patient*innen und Ärzt*innen
4.1 Dürfen Ärzt*innen und Krankenhäuser eine medizinische Behandlung von HIV-positiven bzw. von an AIDS erkrankten Menschen ablehnen?
Notfälle
Ärzt*innen und Krankenhäuser dürfen die Behandlung von Menschen mit HIV und AIDS in Unglücksfällen nicht ablehnen, beispielsweise wenn durch plötzliche Ereignisse eine erhebliche Gefahr für die Patient*in besteht. Davon umfasst sind Fälle der unterlassenen Hilfeleistung nach § 323c StGB, wonach jeder eine Hilfeleistungspflicht innehat. Ärzt*innen werden in der Regel professionelle und sachgerechte Hilfe leisten können und sind daher nach § 323c StGB verpflichtet.
Kassenärzte
Die Behandlung von Patient*innen, welche einer gesetzlichen Krankenkasse angehören, dürfen sog. „Kassenärzt*innen“ (Ärzt*innen, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung zugelassen sind) nur in begründeten Fällen ablehnen. Dies umfasst etwa Überlastung, mangelnde fachliche Fähigkeiten, unzureichende apparative Ausstattung oder eine tiefgreifende Störung des Vertrauensverhältnisses. Eine solche Verpflichtung ergibt sich einerseits aus § 13 Abs. 7 S. 3 des Bundesmantelvertrags – Ärzte (Link) als auch direkt aus § 95 Abs. 3 S. 1 SGB V. Zu beachten ist aber, dass eine solche Verpflichtung der Ärzt*innen nicht direkt gegenüber den Patient*innen besteht. Bei dem Bundesmantelvertrag – Ärzte handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen, u.a., der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Landesverbänden der Krankenkassen, zu dem die Patient*innen nicht Vertragspartei sind. Auch für die Verpflichtung aus § 95 Abs. 3 SGB V gilt, dass diese Verpflichtung der Kassenärzt*innen lediglich durch die Kassenärztliche Vereinigung durchgesetzt werden kann. Sollten Ärzt*innen und Krankenhäuser die Behandlung wegen einer HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung verweigern, ist Patient*innen zu raten, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder zur Verfügung gestellten Beschwerdemöglichkeiten zu nutzen. Diese können bei einer grundlosen Behandlungsverweigerung Sanktionen im Sinne des § 81 Abs. 5 SGB V gegenüber den Ärzt*innen durchsetzen.
Allgemeiner Schutz durch das AGG sowie Privatärzte
Ob eine allgemeine Verpflichtung von Ärztin*innen und Krankenhäusern zur Behandlung von Patient*innen – von Notfällen oder besonderen rechtlichen Verpflichtungen abgesehen – besteht, wird in der Rechtsprechung und Literatur nicht einheitlich beantwortet, aber wohl überwiegend verneint. Lediglich bei Behandlungen, die ein „Massengeschäft“ im Sinne des § 19 Abs. 1 Abs. 1 S. 1 AGG darstellen oder diesem ähneln, wird wohl eine Verpflichtung der Ärzt*innen zur Behandlung der Patient*innen angenommen, beispielsweise bei physiotherapeutischen Behandlungen (KG Berlin, Hinweisbeschluss vom 12.12.2018 – 20 U 160/16) oder der Erbringung von Leistungen der Röntgendiagnostik (MüKoBGB/Thüsing, 9. Aufl. 2021, AGG § 19 Rn. 46). In solchen Fällen dürfen wohl auch Privatärzte und Privat-Krankenhäuser die Behandlung von Patient*innen nicht verweigern.
Hintergrund
Wie bereits dargestellt, ist die Frage, ob eine allgemeine Verpflichtung von Ärztin*innen und Krankenhäusern zur Behandlung von Patient*innen besteht und somit Patient*innen nicht wegen, beispielsweise einer HIV-Infektion, abgewiesen werden dürfen, in der Rechtsprechung und Literatur umstritten, wird aber wohl überwiegend verneint.
In „Standpunkte – Ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz auf medizinische Behandlungsverträge anwendbar? (Nr. 01 – 09/2020)“ der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird eine solche allgemeine Verpflichtung von Ärzt*innen, wie politisch zu befürworten, schon aus dem Genfer Gelöbnisses des Weltärztebundes hergeleitet, wonach diskriminierende Merkmale nicht das ärztliche Handeln bestimmen dürfen. Ein solch ethisches Bekenntnis erzeugt jedoch keine rechtliche Bindung. Dafür spricht auch, dass die (Muster-)Berufsordnung der Bundesärztekammer in § 7 Abs. 2 S. 2 ausdrücklich besagt, dass Ärzt*innen – von Notfällen oder besonderen rechtlichen Verpflichtungen abgesehen – Behandlung ablehnen dürfen. Hier wäre zum Schutze vor Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen wünschenswert, wenn die (Muster-) Berufsordnung das Recht zur Ablehnung einer Behandlung nur in begründeten Ausnahmefällen vorsieht.
Die Befürworter*innen einer allgemeinen Verpflichtung zur Behandlung von Patient*innen stützen sich auf das AGG und sehen in der Behandlung von Patient*innen ein sog. „Massengeschäft“ (oder ein diesem ähnelndes Geschäft) im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG. Diese Einstufung hätte zur Folge, dass die Ablehnung einer Behandlung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität unzulässig wäre. Massengeschäfte sind dabei Schuldverhältnisse, die typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bejaht einen solchen einem Massengeschäft vergleichbaren Vertrag bei Behandlungsverträgen, da Ärzt*innen beziehungsweise Krankenhäuser die Patient*innen typischerweise nicht individuell aussuchen, sondern versprechen, grundsätzlich alle Menschen, die eine ärztliche Leistung in Anspruch nehmen wollen, zu untersuchen, zu behandeln oder zumindest weiter zu verweisen. Persönliche Merkmale der Patient*innen seien zwar für die individuelle Behandlung entscheidend, jedoch nicht für das (vorgelagerte) Zustandekommen eines Behandlungsvertrags (Däubler/Beck/Bernhard Franke/Gisbert Schlichtmann, 5. Aufl. 2022, AGG § 19 Rn. 39). Einen einem Massengeschäft ähnelnden Vertrag hat beispielsweise das Kammergericht (KG) Berlin ausdrücklich bei physiotherapeutischen Behandlungsverträgen angenommen (Hinweisbeschluss vom 12.12.2018 – 20 U 160/16).
Dem gegenüberstehend wird teilweise bei gesundheitsbezogenen Leistungen wegen der Ausrichtung des Leistungsinhalts an die körperliche Verfasstheit der Patient*innen ein Massengeschäft (oder ein diesem ähnelndes Geschäft) grundsätzlich abgelehnt (BeckOGK/Mörsdorf, 1.7.2024, AGG § 19 Rn. 36). Im Gegensatz zur Entscheidung des KG Berlins hatte das AG Wipperfürth zuvor für therapeutische Behandlungsverträge in Form von Krankengymnastik ausdrücklich im Fall eines HIV-Infizierten ein Massengeschäft und folglich auch den Diskriminierungsschutz des AGG abgelehnt (Urteil vom 25.09.2014 - 9 C 379/13). Als weiteres Argument wird dabei die Gesetzesbegründung zum AGG angeführt (BT-Drucksache 16/178, S. 31 f.). Darin heißt es, dass bei einem privatem Arztvertrag das „zivilrechtliche Benachteiligungsverbot aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft nach § 19 Abs. 2 [AGG]“ einschlägig sei. Der Diskriminierungsschutz des § 19 Abs. 2 AGG umfasst zwar ausdrücklich „Gesundheitsdienste“ über den Verweis auf § 2 Abs. 1 Nr. 5 AGG – schützt dagegen aber nur vor Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft. Daraus wird im Umkehrschluss gezogen, dass nach der gesetzlichen Intention der Diskriminierungsschutz des § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG für Massengeschäften (oder diese ähnelnden Geschäfte) nicht auf ärztliche Behandlungsverträge anwendbar ist (vgl. Armbrüster in: Erman, BGB, 17. Auflage 2023, § 19 AGG Rn. 20).
Eine vermittelnde Ansicht differenziert dabei nach dem Grad der Standardisierung der Arztverträge (MüKoBGB/Thüsing, 9. Aufl. 2021, AGG § 19 Rn. 46; so wohl auch Armbrüster in: Erman, BGB, 17. Auflage 2023, § 19 AGG Rn. 20). Diese Standardisierung wird beispielsweise bei der Erbringung von Leistungen der Röntgendiagnostik angenommen, da hier regelmäßig die Herstellung von radiologischen Bildern durch Rückgriff auf medizinische Gerätschaften im Vordergrund steht (MüKoBGB/Thüsing, 9. Aufl. 2021, AGG § 19 Rn. 46). Eine solche Standardisierung sei bei Behandlungsverträgen nicht gegeben, wenn die Behandlung ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Ärzt*in und Patient*in voraussetzt und dieses Vertrauensverhältnis eine Voraussetzung für den Vertragsschluss darstellt, wie beispielsweise bei psychotherapeutischen Therapieverträgen (ebenda).
Wegen dieser rechtlichen Unsicherheiten ist es erforderlich und wünschenswert, dass der Gesetzgeber durch eine Klarstellung im Gesetzeswortlaut verdeutlicht, dass der weite Diskriminierungsschutz des § 19 Abs. 1 AGG grundsätzlich auf medizinische Behandlungsverträge anwendbar ist. Eine solche allgemeine Verpflichtung zur Behandlung von Patient*innen sollte neben der selbst auferlegten ethischen Verpflichtung von Ärzt*innen durch das Genfer Gelöbnis auch gesetzlich ausgestaltet sein.
4.2 Muss ich in einen HIV-Test einwilligen?
Patient*innen müssen nicht alles akzeptieren, was ihre Ärzt*innen für sinnvoll oder geboten halten. Ärzt*innen müssen das Persönlichkeitsrecht und die körperliche Unversehrtheit ihrer Patient*innen auch dann respektieren, wenn diese es ablehnen, eine lebensrettende Behandlung oder Operation zu dulden. Vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme ist der*die Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung der Patient*innen einzuholen. Die Vornahme einer solchen Maßnahme ohne eine entsprechende Rechtfertigung durch eine (tatsächliche, mutmaßliche oder hypothetische) Einwilligung, kann sowohl zivilrechtlich Schadensersatzforderungen begründen und strafrechtlich ggf. eine Körperverletzung darstellen. Dies gilt auch für eine Untersuchung auf Vorliegen einer HIV-Infektion. Im Rahmen einer allgemeinen Diagnostik, die auch eine Blutanalyse umfasst und wozu die Patient*in eine Einwilligung zur Vornahme dieser allgemeinen Untersuchung erteilt, darf eine Untersuchung auf eine HIV-Infektion durchgeführt werden. Sollte die Patient*in eine Untersuchung auf eine HIV-Infektion nicht wünschen, so ist es ratsam, bei allgemeinen, breit gefächerten Blutuntersuchungen den Untersuchungsumfang nachzufragen, diesen ggf. einzugrenzen und die Ärzt*in darauf hinzuweisen, dass die gegebene Einwilligung eine Untersuchung auf eine HIV-Infektion nicht umfasst. Nicht erlaubt ist es, ohne jeglichen Verdachtsgrund und gegen den Willen des Patienten eine Blutuntersuchung zu veranlassen, um Hinweise auf eine HIV-Infektion zu erhalten (sog. Ausforschungsdiagnostik).
Hintergrund
In den späten achtziger Jahren wurde von großen Teilen der Literatur und Rechtsprechung vertreten, dass Patienten vor einem HIV-Test ausdrücklich aufgeklärt werden müssen. Dies basierte auf der besonderen Stellung der HIV-Infektion, die oft mit Stigmatisierung und gesellschaftlicher Isolation verbunden war. Damals bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit des baldigen Todes aufgrund fehlender Therapiemöglichkeiten (m.w.N. Kern, in: Laufs/Kern/Rehborn, Handbuch des Arztrechts, 5. Auflage 2019, § 51 Fn. 23).
Heutzutage hat sich die Situation jedoch erheblich verbessert. Dank fortschrittlicher Therapien ist HIV zu einer chronischen, aber behandelbaren Erkrankung geworden, und die Lebenserwartung und Lebensqualität der Betroffenen hat sich deutlich erhöht. Die allgemeine Aufklärung hat Vorurteile abgebaut und das Bewusstsein geschärft, dass HIV nicht nur Risikogruppen betrifft (LG Magdeburg, Urteil vom 19.11.2013 - 2 S 140/13, BeckRS 2014, 3364). Die Rechtsprechung sieht daher keine Notwendigkeit, die Einwilligung in einen HIV-Test anders zu behandeln als die in die Untersuchung auf andere schwere Infektionskrankheiten wie beispielsweise Hepatitis C (LG Magdeburg, Urteil vom 19.11.2013 - 2 S 140/13, BeckRS 2014, 3364; vgl. LG Karlsruhe, Urteil vom 25.6.2009, 5 O 36/09, bestätigt durch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 20.4.2010, 7 U 136/09).
Allgemein ist die Einwilligung von Patient*innen in eine Behandlung oder Operation nur wirksam, wenn diese zuvor durch ihre Ärzt*innen über das Wesen, die Bedeutung und die Folgen der Behandlung oder des Eingriffs und die damit verbundenen Risiken umfassend aufgeklärt worden sind (vgl. §§ 630d, 630e Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). Einwilligungsberechtigt sind grundsätzlich nur die Patient*innen selbst. Die Einwilligungsfähigkeit hängt nicht von der Geschäftsfähigkeit, sondern nur von der Einsichtsfähigkeit, die Gefahren Konsequenzen einer Behandlung abzuwägen und der allgemeinen Willensfähigkeit ab.
Ist eine erwachsene Person willensunfähig, muss eine „Betreuung“ bestellt werden. Die Auswahl obliegt dem Vormundschaftsgericht. Betroffene können schon in gesunden Tagen festlegen, etwa in einer Vollmacht in Gesundheitsfragen, einer Vorsorgevollmacht oder einer Patient*innenverfügung, wer notfalls zur Betreuer*in bestellt werden soll. Das Vormundschaftsgericht ist an den Vorschlag gebunden, wenn er dem Wohl der Betroffenen nicht zuwiderläuft.
4.3 Datenschutzrechte
Die DSGVO gewährt Patient*innen bestimmte Rechte in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten gegenüber behandelnden Ärzt*innen.
Nach Art. 13 und 14 DSGVO müssen Patient*innen u.a. darüber informiert werden, welche Daten über sie für welche Zwecke erhoben und wie lange diese gespeichert werden. Auch müssen Arzt*innen betroffene Personen über deren Datenschutzrechte informieren. Zu diesen Rechten gehören etwa das Recht auf Berichtigung unzutreffender Daten, das Recht auf Übertragbarkeit (z.B. bei einem Ärzt*innenwechsel) und unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Löschung. Diese Informationspflichten sind von Ärzt*innen proaktiv vor der ersten Erhebung bei Patient*innen zu erfüllen, zum Beispiel durch eine ausgehängte oder ausgehändigte Datenschutzerklärung. Die Informationspflichten müssen Ärzt*innen auch dann erfüllen, wenn sie die Daten nicht direkt bei Patient*innen, sondern bei Dritten (z.B. anderen Ärzt*innen) erheben.
Praktisch wichtig ist für betroffene Personen in der Regel das Auskunftsrecht. Art. 15 Abs. 1 DSGVO gibt Patient*innen das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche ihrer Daten von Ärzt*innen verarbeitet werden. Anspruchsgegner*in ist jeweils die verantwortliche juristische oder natürliche Person, i.d.R. die Arztpraxis oder das Krankenhaus. Zu den Pflichtangaben gehört u.a., ob Daten über die jeweiligen Patient*innen verarbeitet werden. Ist dies der Fall, müssen die Verantwortlichen alle personenbezogenen Daten über die betroffene Person auflisten, also insbesondere auch, ob eine HIV-Infektion bzw. AIDS-Erkrankung vorliegt und ggfs. wann welche Werte gemessen wurden. Zu den weiteren Pflichtangaben nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO gehören Angaben zu den Verarbeitungszwecken, zur Herkunft der Daten und an welche Empfänger die Daten übermittelt wurden. Nach Art. 15 Abs. 3 DSGVO können Patient*innen zudem eine kostenlose erste Kopie ihrer Patient*innenakte anfordern. Die Kopie kann elektronisch erteilt werden.
Tipp:
Sind Patient*innen sich unsicher, was ihre behandelnden Arzt*innen über sie wissen, bietet das kostenlose Recht auf Auskunft eine einfache und schnelle (i.d.R. ist die Auskunft innerhalb eines Monats zu erteilen) Möglichkeit, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche persönlichen Daten Ärzt*innen über sie haben.
5. Private Lebens- und Krankenversicherungen
Vor dem Abschluss einer privaten Lebens- oder Krankenversicherung sind die Gesundheitsfragen des Versicherers zu beantworten. Die Fragen umfassen in der Regel auch eine HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung. Die HIV-Infektion (selbst wenn Krankheit noch nicht ausgebrochen ist) oder AIDS-Erkrankung muss angezeigt werden. Es handelt sich in diesem Zusammenhang um eine zulässige Frage – lediglich die bloße Frage nach homosexuellen Neigungen oder häufig wechselnden Sexualpartner*innen sind wohl unzulässig. Für die meisten (insbesondere private Kranken-) Versicherer stellt schon eine HIV-Infektion ein Ausschlusskriterium dar. Sollte eine HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung verschwiegen werden, kann sich (und wird häufig sich auch) der Versicherer von dem Versicherungsvertrag lösen und der entsprechende Versicherungsschutz entfällt (§§ 19 ff. VVG). Eine Ausnahme besteht lediglich beim Basistarif privater Krankenversicherungen: Personen, die keine gesetzliche Krankenversicherung abschließen können, aber aufgrund der Versicherungspflicht eine Krankenversicherung benötigen, haben die Möglichkeit, sich zu einem Basistarif bei einer privaten Krankenversicherung zu versichern, da hier die privaten Krankenversicherungen unabhängig von Gesundheitsfragen zum Abschluss der Versicherung verpflichtet sind.
Vor der Einführung des AGG im Jahr 2006, welches die Diskriminierung wegen der sexuellen Identität grundsätzlich verbietet, haben sich sehr viele der privaten Lebens- und Krankenversicherungen geweigert, mit schwulen Männern Verträge abzuschließen, weil sie das „AIDS-Risiko“ fürchteten. Sie haben zwar nicht nach der sexuellen Identität der Antragstellenden gefragt oder vor dem Vertragsabschluss einen HIV-Test verlangt, sondern den Vertragsabschluss ohne Begründung abgelehnt, wenn Antragstellende verpartnert waren oder in ihren Anträgen einen anderen Mann als Begünstigten benannt hatten. Die Abgelehnten wurden in eine „Schwarze Liste“ aufgenommen mit der Folge, dass sich auch alle anderen Versicherer weigerten, mit ihnen einen Vertrag abzuschließen. Zunächst sah es so aus, als ob die Lebens- und Krankenversicherer statt der Ablehnung der Verträge nun von schwulen Männern umfangreiche Gesundheitsuntersuchungen einschließlich eines HIV-Antikörpertests verlangen würden.
Inzwischen scheint sich das Problem aber insgesamt erledigt zu haben. Wir erhalten keine Hinweise und Anfragen mehr wegen Benachteiligung von schwulen Männern durch Lebens- oder Krankenversicherungen. Sollte im Einzelfall doch wegen der sexuellen Identität des zu Versichernden ein Versicherer den Abschluss einer privaten Lebens- oder Krankenversicherung ablehnen, oder einen Risikozuschlag nur wegen der sexuellen Identität fordern, ist zu beachten, dass rechtlich nicht abschließend geklärt ist, ob eine solche Ungleichbehandlung zulässig wäre. Laut AGG ist eine unterschiedliche Behandlung bei einer privatrechtlichen Versicherung aufgrund der im AGG genannten Merkmale nur zulässig, „wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen.“ (§ 20 Abs. 2 Satz 2 AGG). Unserer Ansicht nach ist eine solche mathematische Herleitung eines höheren Risikos den Lebens- und Krankenversicherungen aus folgenden Gründen nicht möglich:
- Es ist nach wie vor nicht bekannt, wie viel Prozent der männlichen Bevölkerung Deutschlands schwul ist. Die Aussagen darüber, wie viele schwule Männer es in Deutschland gibt, gehen noch immer weit auseinander.
- Die Statistiken über Todesursachen (Sterbetafeln) unterscheiden nicht zwischen heterosexuellen und schwulen Männern.
- Die Zahlen über die an AIDS verstorbenen schwulen und heterosexuellen Männer sind nicht zuverlässig. Bei AIDS-Kranken wird regelmäßig nicht AIDS als Todesursache angegeben, sondern die Krankheitserscheinung (opportunistische Infektion), die die unmittelbare Todesursache war.
Sollten Sie den Verdacht haben, dass eine private Krankenversicherung den Abschluss einer Versicherung mit Ihnen pauschal wegen Ihrer sexuellen Orientierung verweigert, empfehlen wir anwaltlichen Rat einzuholen.
Ist man schon bei einer privaten Lebens- oder Krankenversicherung versichert und erfährt von einer HIV-Infektion, so bleibt der laufende Versicherungsvertrag und dessen Versicherungsschutz bestehen. Die Behandlungskosten werden grundsätzlich wie jede andere Erkrankung übernommen.
Seit 2019 werden die Kosten der HIV- Präexpositionsprophylaxe (PrEP) von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen (vgl. § 20j SGB V). Uneinheitlich scheint das Bild bei den privaten Krankenkassen zu sein – lediglich ein Viertel der privaten Krankenkassen sollen die Kosten für (bereits versicherte) PrEP-Nutzer*innen übernehmen. Manche Versicherer schließen Neuversicherte von der Kostenübernahme komplett aus, oder versichern PrEP-Nutzer*innen gar nicht erst. Magazin.hiv stellt eine Übersicht basierend auf einer Umfrage der Deutschen Aidshilfe zur Verfügung, wie sich die einzelnen privaten Krankenkassen zum Thema PrEP positionieren („Die HIV-PrEP bleibt für viele Privatversicherte ein finanzielles Risiko“).
6. Private Altersvorsorge
Sowohl bei der Regelaltersrente als auch einer Erwerbsminderungsrente ist eine private Altersvorsorge erforderlich, um später den eigenen Lebensstandard aufrecht zu halten. Auch wenn private Lebensversicherungen wegen ihrer Gesundheitsfragen HIV-Infizierte und AIDS-Erkrankte ablehnen oder nur mit entsprechenden Risikozuschlägen, Karenzzeiten und Ausschlussklauseln versichern, ist eine private Altersvorsorge neben der Selbstbestimmten Anlage, bspw. über einen ETF-Sparplan, auch über eine Riester/Rürup Rente oder eine private Rentenversicherung möglich. In diesen Fällen erfolgt gerade keine Gesundheitsprüfung. Welche der möglichen Wege zur privaten Altersvorsorge für einen persönlich am besten sind, kann in einem Beratungsgespräch mit den örtlichen Verbraucherzentralen oder einer (Honorar-)Versicherungsberater*in oder Finanzanlagenberater*in geprüft werden. Generell sind Honorar-Berater*innen vorzuziehen gegenüber Versicherungs- /Finanzanlagenvermittlern, bspw. Ihrer Hausbank (auch wenn sie sich oft als „Berater“ bezeichnen), da diese unabhängig von eigenen finanziellen (Provisions-) Interessen beraten. Wichtige Informationen zur privaten Altersvorsorge finden Sie auch im Internet auf der Homepage der Verbraucherzentrale.
Weiterlesen
- Rechtsprechung zu HIV und AIDS: Arbeitsrecht - Beamtenbewerbung - Berufskrankheit - Blutspende - Datenschutz - Grundsicherung und Sozialhilfe - Heilbehandlung - HIV-Antikörpertest - Kündigung - Opferentschädigung - Polizei - Schweigepflicht - Schwerbehinderung - Strafrecht - Strafvollzug - Versicherungen - Zeugnisverweigerungsrecht
- HIV-Prävention stärken, soziale Situation von Menschen mit HIV und AIDS verbessern. Positionen des LSVD

